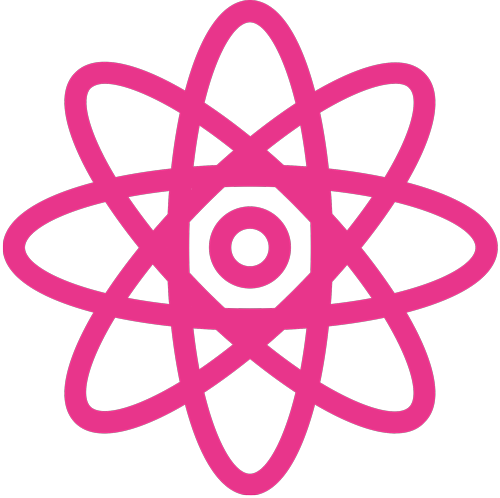Rethink Labels – Words make Worlds: Wie sinnvoll sind Kategorien?
Worte können motivieren und mobilisieren – oder abstempeln und einfrieren. Wer in Diagnosen und starren Kategorien denkt, verpasst unterschiedliche Facetten des menschlichen Daseins. Labels sind sprachliche Vereinfachungen mit weitreichenden Folgen. Dieser Artikel analysiert ihre Wirkung auf Therapie, Denken und Identität. Denn während unser Gehirn evolutionär darauf programmiert ist zu kategorisieren, kann diese Tendenz in der modernen Schmerztherapie mehr schaden als nützen. Warum etikettieren wir eigentlich so gerne? Und welche Auswirkungen haben unsere Labels auf Therapeuten, Patienten und die Art, wie wir Schmerzursachen interpretieren? Zeit für eine ehrliche Bestandsaufnahme.
Die evolutionäre Falle: Warum wir kategorisieren müssen – aber nicht sollten
Unser Gehirn kategorisiert automatisch, und das aus gutem Grund. Evolutionär half uns diese Fähigkeit dabei, schnelle Entscheidungen zu treffen, Energie zu sparen, Komplexität zu reduzieren und lebensrettende Muster zu erkennen. Säbelzahntiger oder harmloses Kätzchen? Diese Unterscheidung musste binnen Sekunden getroffen werden.
Doch was in der Savanne überlebenswichtig war, kann in der modernen Schmerztherapie kontraproduktiv werden. Unsere Kategorisierungswut führt zu drei problematischen Bereichen: der Selbstlimitierung von Therapeuten, der Reduzierung von Patienten auf ihre Diagnosen und der vorschnellen Kausalitätszuschreibung bei Schmerzursachen. Alle drei Bereiche verdienen eine kritische Betrachtung.
Das therapeutische Selbstlabeling: Gefangen in der eigenen Kategorie
„Ich bin ein Hands-off-Therapeut.“ So cool und modern das klingt, so unsinnig ist die Aussage zugleich. Viele Therapeuten kategorisieren sich selbst und schaffen damit künstliche Grenzen, die ihrer therapeutischen Flexibilität schaden.
Wer sich komplett als „Hands-off-Therapeut“ definiert, verkennt die Wirkung von Berührung. Es ist etwas anderes, keine spezifischen manualtherapeutischen Techniken zu preisen oder die propagierte Wirkungsspezifität kritisch zu sehen, als Berührung generell abzulehnen. Umgekehrt macht aktive Therapie nicht automatisch zu einem besseren Therapeuten.
„Ich habe Übungen gemacht.“ Okay, wie und was? Ein Heimprogramm zur Stabilisierung der Bandscheiben und Vermeidung von Scherkräften? Dann mach lieber Hands-On-Therapie. Gut gemeint, schlecht gemacht. Ich nenne sie nocebische Hands-Off-Therapeuten: „Macht Krafttraining, damit die Wirbelsäule stabil bleibt.“ Ja, Krafttraining lindert Schmerzen – aber nicht durch biomechanische Mechanismen. Oder: „Trainieren Sie Kniestabilität, damit die Schmerzen, die durch den Valgus verursacht werden, gelindert werden.“ Schmerzen werden gelindert, Valgus ist da. Ups, Biomechanik war doch nicht der Grund für den Schmerz.
Ein weiteres Beispiel: Der „Neuro-affine-Therapeut“, der auf Embodiment, PNE und psychologische Interventionen schwört – aber dabei den Menschen nicht mehr berührt oder einfache passive Maßnahmen ablehnt, obwohl diese manchmal genau das sein könnten, was ein der Patient braucht. Oder der klassische „Übung-ist-die-Lösung-für-alles“-Therapeut, der über Kontextualisierung spricht, aber bei schlechter Compliance direkt von „fehlender Motivation“ redet, statt über das Maß, die Komplexität oder die individuelle Alltagsintegration nachzudenken.
Wer sich zu stark labelt, verpasst die Chance, das gesamte Repertoire sinnvoll auszubalancieren! Das Problem von therapeutischem Selbstlabeling liegt in den selbst auferlegten Beschränkungen, dem Verlust therapeutischer Flexibilität und dem Schwarz-Weiß-Denken statt individueller Anpassung. Besser wäre: „Ich passe meine Methoden an jeden Menschen individuell an.“
Das Patienten-Labeling: Vom Menschen zur Diagnose
Das Reduktionismus-Problem unserer Zeit: Labeling reduziert komplexe Menschen auf „den Bandscheibenpatient“, „die Fibromyalgie-Patientin“ oder „den chronischen Rückenschmerz“. Diese Etikettierung löst einen verheerenden Nocebo-Effekt aus, bei dem Labels negative Erwartungen verstärken und zu selbsterfüllenden Prophezeiungen werden. Ein typisches Beispiel: „Sie haben einen Bandscheibenvorfall“ führt dazu, dass der Patient denkt: „Ich bin kaputt.“ Die Folgen sind Angst vor Bewegung, Schonung und eine passive Opferrolle. „Chronischer Schmerzpatient“ erzeugt Hoffnungslosigkeit, während „Fibromyalgie-Patientin“ zur Identifikation über die Krankheit führt. Labels werden zu selbstlimitierenden Glaubenssätzen.
Folgen von Patienten-Labels
Auf Verhaltensebene entstehen folgenreiche Muster: Bewegungsvermeidung, Rückzug aus Sport oder Alltagstätigkeiten, ständige Schonhaltung und ein hoher Informationskonsum mit Fokus auf Schädigung statt Heilung. Viele beginnen, sich selbst und ihren Körper zu überwachen: „Knackt es da? Ist das gefährlich? Hab ich was falsch gemacht?“ Die Kontrollinstanz wandert nach außen – Patienten vertrauen nicht mehr sich selbst, sondern suchen ständige Bestätigung durch Diagnostik, Bildgebung und Fachmeinungen. Das ist kein Mangel an Willen, sondern Ausdruck eines Label-basierten Verlusts von Selbstwirksamkeit. Besonders perfide: Selbst wenn sich die Symptome verbessern, bleibt das Label oft haften. Es wird Teil der Identität. Aussagen wie „Ich habe einen kaputten Rücken“ oder „Ich muss mein Leben anpassen“ werden langfristig zur Lebensrealität – obwohl sich die Gewebesituation längst normalisiert hat. Damit entstehen selbstverstärkende Schleifen, in denen die ursprüngliche Diagnose nicht mehr der Startpunkt zur Heilung, sondern der Startpunkt zur chronischen Krankheitsidentität wird.
Das zeigt sich deutlich am Beispiel von einer ehemaligen Patientin von mir. Erika, 45 Jahre: Vorher sagte sie: „Ich bin Fibromyalgie-Patientin“ – ihre Identität war die Krankheit, sie befand sich in einer passiven Opferrolle mit eingeschränkten Aktivitäten. Nachher: „Ich bin Erika mit Schmerzerfahrungen“ – der Mensch steht im Fokus, sie wird zur aktiven Gestalterin und ihre Ressourcen werden sichtbar. Dazu kommen gesellschaftlich geprägte Labels, die außerhalb der Therapieräume wirken: „Schmerzpatienten sind schwierig“, „Psychosomatik ist gleichbedeutend mit Simulieren“, „chronischer Schmerz ist nicht mehr beeinflussbar“. Diese stillen Narrative sickern auch in Therapiegespräche ein und beeinflussen, wie Patienten sich selbst wahrnehmen. Sprache wie „Sie müssen damit leben lernen“ oder „Damit müssen wir uns arrangieren“ kann fataler wirken als jede MRT-Diagnose. Denn was ein Mensch glaubt, was ihm möglich ist – ist oft mächtiger als jede Maßnahme.
Die Kausalitäts-Falle: Wenn Korrelation zur Ursache wird
Wir sind nicht nur schnell im Kategorisieren von Menschen, sondern auch beim Zuschreiben von Schmerzursachen. Die Wortwahl ist hier entscheidend und folgt einem gefährlichen Pattern.
Ein klassisches Beispiel: Ein Patient mit Nackenschmerzen zeigt eine ausgeprägte HWS-Anteroposition, wobei „ausgeprägt“ schon Interpretationssache ist. Die typische Schlussfolgerung lautet: „Die Lordose führt zu Ihren Kopfschmerzen.“ Doch betrachten wir die Aussageintensität genauer.
Zusammenhänge zwischen zwei Parametern können drei verschiedene Intensitäten haben:
- Ursache: „Die Lordose führt zu Schmerzen“ (Kausalität)
- Treiber: „Die Lordose begünstigt die Schmerzen“ (Begünstigung)
- Ko-Existenz: „Es ist eine Lordose zu beobachten“ (Korrelation)
„Kann“-Aussagen sind schwieriger zu widerlegen als „Ist“-Aussagen, weil sie Wahrscheinlichkeiten statt Absolutheiten thematisieren. Und genau hier setzt reflektiertes Denken an: Wie wahrscheinlich ist es, dass eine spezifische Haltung die einzige Ursache für die Schmerzen ist? Aussageintensität Nummer 1 scheint ziemlich abwegig.
Doch auch das Gegenteil kann extrem werden. Wenn Studien zeigen, dass spezifische Haltungstypen nicht mit erhöhtem Schmerzrisiko korrelieren, hört man schnell: „Haltung ist völlig irrelevant, warum schaust du dir 2024 überhaupt noch die Haltung an?“ Die Wahrheit liegt in der Grauzone: Studienergebnisse zeigen zwar, dass Lordose im Durchschnitt nicht mit mehr Schmerzen korreliert, aber das macht Haltung nicht komplett irrelevant.
Lösungsansätze: Raus aus der Label-Falle
Die Alternative zu destruktivem Labeling liegt in bewussten Sprachwechseln und Denkmustern:
Person-first Language verwenden: „Person mit Rückenschmerzen“ statt „Rückenschmerzpatient“. Der Fokus liegt auf Ressourcen und Fähigkeiten, während wir individuelle Schmerzgeschichten erkunden, Hoffnung und Selbstwirksamkeit stärken und ein biopsychosoziales Verständnis vermitteln.
Ein kleiner, aber entscheidender Unterschied zeigt sich bereits in unserer Wortwahl: „Ich habe schon viele Bandscheibenpatienten behandelt“ vs. „Ich habe schon viele Menschen behandelt, die einen Bandscheibenvorfall hatten.“ Beides mag inhaltlich ähnlich gemeint sein – aber die Wirkung ist grundverschieden. Im ersten Fall wird der Mensch auf seine Diagnose reduziert, im zweiten bleibt er Subjekt seiner Geschichte. Die erste Aussage bestätigt das Label, die zweite entkoppelt es vom Selbstbild. Sprache ist nicht neutral. Sie formt Realitäten, erzeugt Bilder im Kopf – und kann entweder zu mehr Identifikation mit dem Problem führen oder zur gesunden Distanz. Wer Menschen statt Diagnosen behandelt, signalisiert nicht nur therapeutische Haltung, sondern ermöglicht auch einen Perspektivwechsel beim Gegenüber.
Ähnlich wie beim Testen, was wir im letzten Artikel diskutiert haben, müssen wir auch beim Labeling die Intention hinterfragen: Dient diese Kategorisierung dem Patienten oder unserem Bedürfnis nach diagnostischer Gewissheit? Labels sollen Kommunikation erleichtern, nicht Menschen definieren.
Ahura = Der Sprach-Polizist?
Bei aller berechtigten Kritik am Labeling bleibt eine wichtige Realität bestehen: Irgendetwas müssen wir unseren Patienten ja sagen. Kommunikation lässt sich nicht vermeiden – sie ist integraler Bestandteil unserer Arbeit. Diese Diskussion soll also nicht dazu führen, dass wir sprachlos oder überkorrekt werden, sondern im Gegenteil: Sie soll inspirieren, bewusster zu sprechen. Es geht nicht darum, jede Formulierung zu verurteilen, sondern sie zu hinterfragen. Vielleicht dient diese Kritik weniger als Verbotstafel, sondern mehr als Denkansatz – als Einladung, Begriffe zu prüfen, zu verfeinern, um sie nützlicher und weniger schädlich zu machen. Denn natürlich braucht es Worte. Die Frage ist nicht ob wir kommunizieren, sondern wie. Welche Bilder rufen wir hervor? Welche Haltungen transportieren wir? Welche inneren Prozesse lösen wir aus? Sprache kann verletzen oder verbinden, festschreiben oder befreien. Sie ist unser Werkzeug – und wie bei jedem Werkzeug gilt: Es kommt auf das „Wie“ an.
Fazit: Für eine entlabelte Therapiekultur
Labels sind evolutionär sinnvoll, können aber in der Schmerztherapie mehr schaden als nützen. Ob therapeutisches Selbstlabeling, Patienten-Etikettierung oder Kausalitätszuschreibung – überall lauern die gleichen Fallen: Reduktionismus, Selbstlimitierung und vorschnelle Schlussfolgerungen.
Lasst uns weniger behaupten und mehr begleiten. Ab heute: Bewusst auf Sprache achten, Menschen nicht Diagnosen behandeln, Ressourcen betonen, Hoffnung säen statt Angst und in Grautönen statt Schwarz-Weiß denken. Eine reflektierte Label-Kultur bedeutet, die Komplexität menschlicher Erfahrung anzuerkennen und unsere Rolle als Begleiter statt als Kategorisierer zu verstehen.
Der nächste Artikel erscheint in 4 Wochen. Ausnahmsweise weiß ich das Thema noch nicht.. ich werde ein cooles Thema finden. Und: Vergiss nicht dich für den Newsletter anzumelden, um nichts zu verpassen. 👇🏼
Melde dich hier an und erhalte regelmäßig Blogartikel automatisch per Mail zugeschickt.
- kostenlos
- werbefrei
- regelmäßig